Wissenschaftsreportage / Technik
Wissenschafts- und Technikthemen mit der kreativen Stilform der Reportage zu verbinden, das ist meine Leidenschaft. So wird für die Leserinnen und Leser fühlbar, wie unsere Zukunft aussieht. Einige meiner großen Technik-Reportagen haben schon öffentliche Diskussionen in Gang gesetzt über die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

spektrum.de, 17. Juli 2015 - Link
„Bitte beschäftigt euch mit unserer Forschung, sie wird euer Leben verändern“: sinngemäß diese Forderung schreit aus einigen Beiträgen im aktuellen „Science“-Magazin zum Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz“ hervor. Die Forscher haben Recht mit ihrem Hilferuf, findet Eva Wolfangel: Es ist Zeit aufzuwachen.
Fahren wir auf eine Klippe zu und hoffen, dass das Benzin leer ist, bevor wir in den Abgrund stürzen? Dieses drastische Bild zeichnet der KI-Pionier Stuart Russel von der University of Califormia in der aktuellen Ausgabe des "Science"-Magazins angesichts all derer, die sagen: Maschinen werden nie intelligenter sein als Menschen. Ob es zu diesem Punkt je kommt, steht in den Sternen. Aber auch das, was selbst lernende Algorithmen heute schon können, fordert eine Neuorientierung der Gesellschaft. Das Bild Russels ist symptomatisch für unseren Umgang mit dem Thema künstliche Intelligenz: Anstatt sich genauer mit dem zu beschäftigen, was die modernen Technologien selbst lernender Systeme an Veränderungen für unser Zusammenleben mit sich bringen, halten wir uns lieber die Augen zu und hoffen, dass es schon gut gehen wird. Einerseits fördert die Gesellschaft entsprechende Entwicklungen mit hohen Fördersummen, andererseits weigern sich Politiker, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Stuttgarter Zeitung, Tagesthema, 17. Juli 2015
Intelligente Maschinen beschäftigen die Menschen derzeit stark. Das Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht einen Themenschwerpunkt über die aktuellen Herausforderungen der künstlichen Intelligenz - und ihre Begrenzungen
Sei es das soziale Netzwerk Facebook, das seine User mittels Künstlicher Intelligenz besser kennen lernen und Werbung noch gezielter platzieren will oder Googles Vision, den Menschen künftig Fragen zu beantworten, bevor sich diese ihnen stellen: Künstliche Intelligenz ist derzeit in viel gefragtes Themenfeld. Ein Grund für das Wissenschaftsjournal „Science“, Künstliche Intelligenz in der aktuellen Ausgabe als Themenschwerpunkt zu behandeln. Schließlich wächst das Thema auch in der Wissenschaft, hohe Fördersummen fließen in entsprechende Projekte. Ein mutmaßlich weiterer Grund: Die Sichtweise der Öffentlichkeit – seien es Befürchtungen vor superintelligenten Robotern bis hin zu übergroßen Hoffnungen, was Maschinen alles leisten könnten – weicht bisweilen von der Realität der Forschung ab. In verschiedenen Artikel beschreiben die Forscher die aktuellen Herausforderungen für die Künstliche Intelligenz – und ihre Begrenzungen.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Bild der Wissenschaft 7/2015 (Auszug)
In der Stadt der Zukunft organisieren Computer den Alltag. Wie sinnvoll ist das?
Intelligente Parkautomaten berechnen den Preis abhängig von der Nachfrage nach Parkplätzen, elektronische Verkehrsschilder passen Geschwindigkeitvorgaben Wetter- und Verkehrsverhältnissen an, öffentliche Mülleimer teilen der Stadtverwaltung mit, wann die Tonne voll ist - und nur dann macht sich das Müllauto auf den Weg, was Kosten spart: Das sind erste bestehende Ansätze der vernetzten Stadt der Zukunft, in der nahezu alle Vorgänge von Computern entschieden werden sollen. Denn in unserem alltäglichen Leben fallen immer mehr Daten an, auf deren Grundlage wir unser Zusammenleben effektiver organisieren könnten. Bürger sind schon heute dank ihrer Smartphones wandelnde Sensoren: Die Geräte messen, wer sich in welcher Geschwindigkeit wo bewegt, sie können Geräusche und Vibrationen registrieren und vieles mehr.
All diese Sensoren sollten vernetzt und durch weitere ergänzt werden, fordern Zukunftsforscher. „Wir haben Millionen von Augen und Ohren auf der Straße“, formuliert es Michael Flowers, Chefanalytiker von New York City. Man müsste diese Daten zusammenführen und auswerten, um den Verkehr zu reduzieren, die Luftqualität zu verbessern, Unfälle zu reduzieren, so seine Vision, kurz: „Schneller, sauberer und sicherer zu leben.“ Eine App teilt beispielsweise der Stadt Boston mit, wenn eine Straße ein Schlagloch hat – ermittelt allein durch die Sensoren des Handys.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik
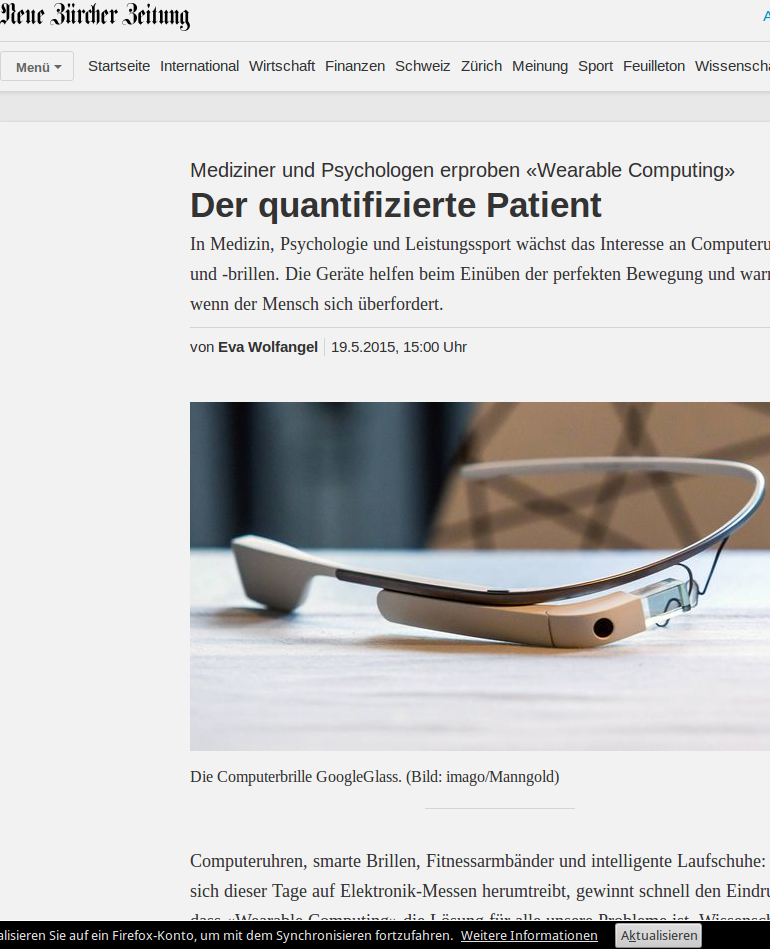
Neue Züricher Zeitung, 20. Mai 2015
Das Interesse an anziehbaren Computern wächst in Medizin, Psychologie und im Leistungssport. Intelligente Brillen und Uhren können Krankheiten oder die perfekte Bewegung berechnen.
Computer-Uhren und smarte Brillen, Fitnessarmbänder und intelligente Laufschuhe: Wer sich dieser Tage auf den Elektronik-Messen herumtreibt, könnte schnell den Eindruck gewinnen, dass „Wearable Computing“ die Lösung für alle unsere Probleme ist. Aber Wissenschaftler dämpfen die Erwartungen. „Vieles ist hochgepoppt, aber jetzt kommt die große Ernüchterung“, fürchtet Gerhard Tröster, Leiter des Elektronik-Labors der ETH Zürich. Ihn treibt wie viele Informatiker die Frage nach dem Usecase – dem Anwendungsfall – der anziehbaren Computer um. Denn auch speziellere Anwendungen, wie sie Fitnessarmbänder versprechen, könnten schnell das Interesse der Kunden verlieren. „Die Quantified-Self-Welle wird schnell wieder abebben“, prognostiziert Tröster. Zudem seien diese Geräte häufig billig gemacht und nicht klinisch getestet, ergänzt Kristof Van Laerhoven, Professor für eingebettete Systeme an der Universität Freiburg: „Was habe ich von einem Messergebnis, von dem ich nicht weiß, ob es richtig ist?“ Wissenschaftlich geprüfte Geräte seien zwar deutlich teurer, Van Laerhoven prognostiziert ihnen aber langfristig eine bessere Marktchance. Schließlich seien Wearables gut geeignet, um physiologische Werte zu messen und Aktivitäten auszuwerten.
Gerade im medizinischen Bereich entstehen aktuell viele Prototypen, die eingearbeitet in Kleidungsstücke beispielsweise Herz-Rhythmus- oder Durchblutungsstörungen erkennen können. Trösters Vision geht darüber hinaus: Daten über physiologische Vorgänge und Aktivitäten eines Menschen können auch Aufschluss über dessen psychische Situation geben. „Ein Psychologe erkennt viele Störungen auf den ersten Blick, er arbeitet mit seinen fünf Sinnen“, sagt Tröster. „Wenn er es sieht, muss man es auch messen können.“
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik
Technology Review 5/2015 (Auszug)
Kritiker warnen, dass digitale Technololgien unsere Intelligenz beeinträchtigen. Doch jetzt zeigen Studien, dass die neuen Medien ganz neue Lernformen ermöglichen und unsere kognitiven Möglichkeiten steigern können.
Ein Schulhof am Rande von Panama-City: Ein Junge kauert unter einem Baum, ein Smartphone in der Hand, ein Englischschulbuch auf den Knien. Aus dem Handy ertönt die Stimme seines Lehrers. Dieser liest den englischen Text aus dem Buch vor. Der Junge lauscht konzentriert. Dann spricht er dem Lehrer nach. Schließlich nimmt er seine Stimme ebenfalls auf und spielt seine Aufnahme und die des Lehrers abwechselnd ab. Unter diesem Baum auf einem panamaischen Pausenhof ist ein modernes Sprachlabor entstanden. Mit denkbar einfachen Mitteln.
Das Experiment hat die panamaische Informatikerin Elba Del Carmen Valderrama durchgeführt. Sie verteilte günstige Smartphones an Schulen ohne spezielle Lernsoftware. Ihre Idee: In Schwellenländern fehlen an Schulen häufig alle technischen Möglichkeiten vom Drucker bis zum Videobeamer um den Unterricht zu bereichern. Was würden also die Schüler und Lehrer mit den Handys machen? Innerhalb weniger Tage fungierten die Geräte als Kopierer und Sprachlabor, die Schüler erledigten darauf Hausaufgaben und sendeten sie an die Lehrer, sie drehten Lernvideos und protokollierten den Unterricht. Sie lernten enthusiastisch.
Valderramas Ergebnisse sind kein Einzelfall. Ähnliche Erfahrungen machte auch Nicholas Negroponte, als er mit seiner Initiative „One Laptop per child“ zwei abgelegene äthiopische Dörfer mit Laptops versorgte: jedes Kind bekam ohne jede Anleitung einen Computer inklusive Solar-Ladeeinheit mit einigen vorinstallierten Apps. Schon nach wenigen Minuten hatten die Kinder, die keine Schule besuchen und weder lesen noch schreiben können, den Einschaltknopf gefunden. Nach fünf Tagen hatten sie alle Apps ausprobiert, wie die Auswertung der Sim-Karten ergab. Nach zwei Wochen sangen die Kinder ein Alphabetlied, die ersten begannen zu schreiben. „Nach fünf Monaten hatten sie Android gehackt“, berichtet Negroponte: die Kamera der Geräte sei versehentlich ausgeschaltet gewesen. Die Kinder hatten sie entdeckt, ein Programm umgeschrieben und sie zum Laufen gebracht.
