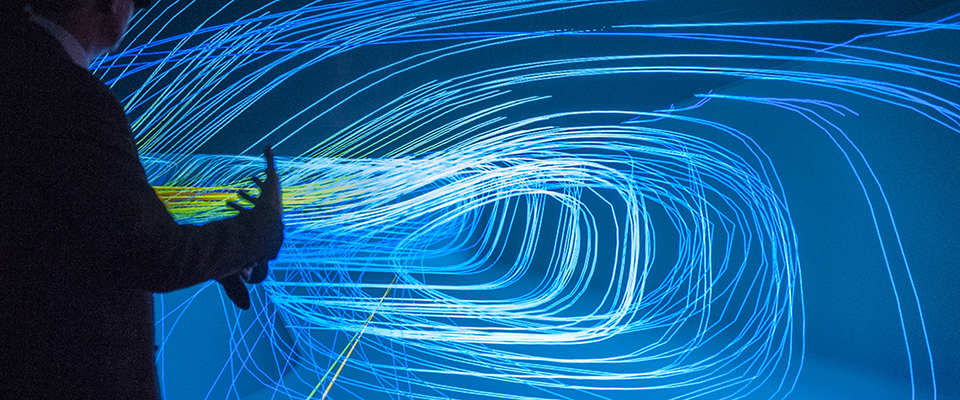Meine Themengebiete
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Bild der Wissenschaft 06/2014 (Auszug)
Der deutsche Astronaut Alexander Gerst startet Ende Mai auf die Internationale Raumstation. Im Interview mit Bild der Wissenschaft spricht er darüber, was er sich von der Forschung erhofft, wieso wir eines Tages andere Planeten bewohnen werden und woran wir außerirdisches Leben erkennen.
- Der gesamte Text darf leider aus rechtlichen Gründen hier nicht erscheinen - deshalb hier nur ein Auszug: Weiterlesen in Bild der Wissenschaft 06/2014 -
(...)
Herr Gerst, Ihre Ausbilder bei der ESA haben versucht, Sie an Ihre Grenzen zu bringen – beispielsweise beim Überlebenstraining: tagelang mit wenig Ausrüstung und kaum Essen in eisiger Kälte im Wald. Erfolgreich?
Ich dachte zwar manchmal: Ja, hier könnte meine Grenze möglicherweise liegen. Aber ich habe gemerkt, dass ich mehr aushalte, als ich mir vorstellen konnte. Selbst das Überlebenstraining oder die anstrengenden Unter-Wasser-Trainings, wo ich sieben Stunden ohne Pause in einem schweren Raumanzug unter Druck anstrengende Arbeiten verrichten musste: Ich dachte anfangs, ich kann das vielleicht nicht – und habe dann gemerkt, dass es wirklich machbar ist. Ich weiß also nicht, wo meine Grenzen sind, ich weiß nur, wo sie nicht sind.
Auf der ISS werden sie monatelang auf engstem Raum mit fünf anderen Astronauten zusammenleben müssen, die teilweise aus anderen Kulturen stammen oder aus Nationen, die sich auf der Erde nicht gerade grün sind. Könnte Sie das an Ihre Grenzen bringen?
Meine Erfahrung aus der Antarktis ist: Je schwieriger die äußeren Umstände, umso enger bringt es das Team zusammen. Auf der ISS arbeiten ehemals verfeindete Nationen schon seit Jahren eng und erfolgreich zusammen. Wir sind dort die einzigen sechs Menschen, die nicht auf dem Planeten sind: das verbindet.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik
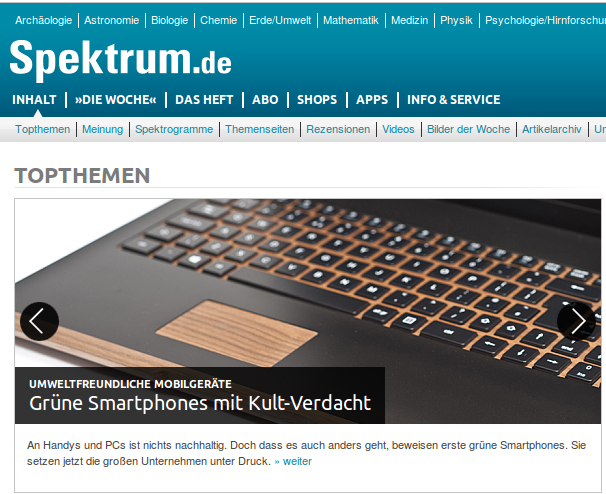
spektrum.de, 21. Mai 2014 - Link
An Smartphones und Tablet-Computern ist nichts nachhaltig. Weil alles immer kleiner wird, lassen sie sich kaum reparieren und landen schnell auf dem Müll. Die Industrie profitiert davon. Erste Beispiele aber zeigen, dass es anders geht. Die großen Unternehmen geraten unter Druck.
Vor eineinhalb Jahren ging die Digitalkamera des niederländischen Designers Dave Hakkens kaputt. Er nahm sie auseinander, sah, dass nur ein kleines Bauteil kaputt war und atmete auf: Man musste es nur austauschen. Doch die Erleichterung hielt nicht lange. „Das war einfacher gesagt als getan“, sagt er heute desillusioniert; nirgends gab es das Teil zu kaufen, niemand konnte die Kamera reparieren. „So wachsen die Berge an Elektroschrott.“ Noch häufiger seien es Smartphones, die wegen eines defekten, nicht austauschbaren Teils komplett entsorgt werden müssten. Umweltschützer und Technologiefan Hakkens ärgerte sich nicht lange, sondern startete „Phonebloks“, eine Kampagne für ein modulares Smartphone, die innerhalb weniger Wochen zig Millionen Anhänger im Netz fand.
Hakkens ist auf ein Problem gestoßen, das viele umtreibt und die Technologie der Zukunft vor eine Herausforderung stellt: Gerade die modernen, auf Miniaturisierung getrimmten mobilen Geräte sind alles andere als „grün“. Bei den wenigsten Smartphones und TabletPCs kann man einzelne kaputte Teile austauschen, meist nicht einmal den Akku. Das verkürzt deren potentielle Lebensdauer: ein kaputtes Teil und das ganze Gerät muss entsorgt werden.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Bild der Wissenschaft, Mai 2014 (Auszug)
Schadet die moderne Technologie unserem Miteinander? Informatiker kommen ins Zweifeln. Sie entwickeln Programme und Apps die persönliche Begegnungen fördern sollen – und plädieren dafür, ab und zu mal offline zu sein.
Die Mail des Informatik-Professors ist ungewöhnlich: „Über dieses Thema habe ich in letzter Zeit vermehrt nachgedacht“, schreibt er an die Journalistin, „vielleicht können wir uns darüber mal unterhalten.“ Er schickt einen Internetlink. Der führt zum Tagebuch von Rachel Stafford, einer jungen Mutter aus Alabama. „Wie man eine Kindheit verpasst“, ist ihr Webblog überschrieben. Darin schildert die Frau, wie sie mit ihrem Smartphone jahrelang in sozialen Netzwerken chattete, Firmenmails beantwortete, Videos schaute – und dabei das richtige Leben verpasste. Erlebnisse mit ihrer Tochter beispielsweise. Sie wolle diese „schmerzhafte Wahrheit“ teilen, um anderen Eltern eine solche Erfahrung zu ersparen.
Moderne Technik zu verdammen, vor den Folgen einer ständigen Online-Präsenz zu warnen, gehört heutzutage schon fast zum guten Ton. Ungewöhnlich ist es, wenn Informatiker darauf verweisen. „Ich bin mir sicher, dass die richtige Anwendung von Technologie sinnvoll ist“, schränkt Albrecht Schmidt, Professor für Mensch-Maschine-Interaktion an der Uni Stuttgart, dann auch ein. Doch was ist sinnvoll? Wie sollten wir Handy, Computer und Co nutzen? „Wir haben entdeckt, dass die Menschen eventuell etwas mehr Zeit online verbringen, als ihnen gut tut“, sagt Nemanja Memarovic von der Fakultät für Informatik der Universität Lugano. Er beobachte, dass immer häufiger Freunde oder Familien zwar beieinander sitzen, aber nicht miteinander reden, weil jeder mit seinem Smartphone beschäftigt ist.
„Von 1997 bis 2009 hat in Großbritannien der Gebrauch elektronischer Geräte zugenommen, gleichzeitig hat die persönliche Kommunikation abgenommen“, zitiert er eine Studie. Das sieht er kritisch: Erst kürzlich hätten Forschungen ergeben, dass etwa Kranke schneller gesünder würden, wenn sie mehr persönliche anstatt digitale Kontakte hätten. „Es wird immer wichtiger, die menschliche Interaktion in unsere reale Welt zurück zu bringen“, sagt Memarovic. Deshalb organisiert er mit Kollegen weltweit Konferenzen, auf denen sich Informatiker darüber austauschen, wie sie persönliche Kontakte zwischen den Menschen fördern können. Ein ganz neuer Forschungszweig ist so entstanden: Er beschäftigt sich mit der Frage der Computer-gestützten sozialen Interaktion.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

spektrum.de, 14. März 2014 - Link
Verrät der Stromzähler bald unsere sexuellen Vorlieben? Bestellt der Kühlschrank eigenständig Butter nach? Diese Sorgen und Hoffnungen verknüpfen die meisten Menschen mit dem "Smart Home", dem intelligenten Haus der Zukunft. Tatsächlich werfen die neuen technischen Möglichkeiten zentrale Fragen auf: Wie fremdbestimmt leben wir im intelligenten Haus? Und sind unsere privaten Daten sicher?
Morgens fragt der Wecker „Geht‘s dir gut?“ und warnt vor dem unregelmäßigen Puls, den die Matratze nachts gemessen hat. Im Bad erinnert unser Spiegel daran, die Medikamente zu schlucken und alarmiert, falls wir die Einnahme verpassen oder mahnt wenn wir zu früh erneut zu den Tabletten greifen. Während die Dusche noch läuft, blubbert in der Küche schon die Kaffeemaschine. Gleichzeitig plant das elektronische Kochbuch auf dem Tablet-Computer das Abendessen, erstellt eine Liste mit den fehlenden Zutaten und verschiebt sie direkt in den Warenkorb eines Online-Supermarktes.
Geht es nach den Forschern des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg können wir künftig von unserem Haus durch den Alltag begleitet werden. Sensoren, etwa in Bett und Hausapotheke, machen es möglich. Solche und weitere Systeme werden im „Intelligenten Haus“, kurz InHaus, in Duisburg getestet. Natürlich lassen sich alle Geräte in der Wohnung auch aus der Ferne via Smartphone-App kontrollieren, selbstverständlich können wir so sehen, wer an der Haustür klingelt – vielleicht der Monteur, den die Heizung gerufen hat. Denn Störungen erkennt sie automatisch, sie regelt sich auch selbständig herunter, wenn die Fenster geöffnet werden oder kein Bewohner da ist. Sind wir im Urlaub, simuliert das Haus unsere Anwesenheit durch verschiedene Lichtschaltungen.
Aber wollen wir so leben?
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Bild der Wissenschaft 1/2014
Die digitale Technologie erobert unser Leben. Selbst dort, wo wir sie nicht erwarten: beim Essen und Trinken.
Ein beliebtes Phänomen: Morgens im Supermarkt landen die Kekse mit Vanillecreme-Füllung im Einkaufskorb. Abends auf dem Sofa liegt die Packung dann unberührt auf dem Tisch, die Sehnsucht wächst zwar – aber nach anderem, zum Beispiel nach Schokoladen-Cookies. Der Kauf erweist sich als Fehlinvestion. Eine Gruppe japanischer Forscher hat dieses Problem auf ihre Art gelöst: Sie erfanden den so genannten „Meta-Cookie“, eine Art Chamäleon-Keks, der seinen Geschmack an die Bedürfnisse des Nutzers anpasst.
Dafür zieht man eine große Maske über Augen und Nase und mustert den Meta-Cookie, einen neutralen Keks mit aufgedrucktem, Computer lesbaren Code. Ein Display vor den Augen zeigt eine Auswahl an Keksgeschmäckern an: Schokolade, Walnuss, Erdbeer oder Vanille. Durch Kopfnicken oder -schütteln kann der Proband eine Gaumenrichtung auswählen, beispielsweise Schokolade. Der Keks im Display überlagert den realen Keks optisch und nimmt jeweils die passende Farbe und Form an. Führt der Proband ihn nun zum Mund um hineinzubeißen, bläst die Maske das passende Aroma in seine Nase: Das täuscht die Sinne so erfolgreich, dass der Nutzer das Gefühl hat, einen Schokoladenkeks zu essen.
Zugegeben: Keine sehr romantische Vorstellung, den Feierabend mit einer riesigen Maske im Gesicht zu verbringen. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich immer so täuschen lassen will“, sagt der Forscher Johannes Schöning, „manchmal will man einfach echte Schokolade genießen.“ Ebenso wie seine japanischen Kollegen gehört der Professor für Informatik an der belgischen Universität Hasselt der noch jungen Forschungsrichtung des „Digital Food“, des digitalen Essens, an. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die digitale Technik immer mehr unserer Lebensbereiche durchdringt und auch vor dem Genuss nicht halt macht. „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt Gedanken machen, was wir wollen und was nicht“, sagt Schöning.