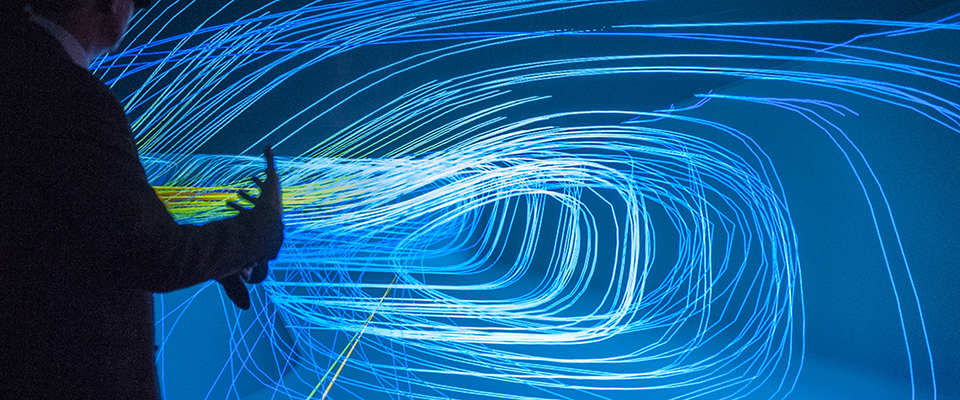Meine Themengebiete
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Die ZEIT, 17. November 2016
Der Technologiekonzern Bosch hat eine für Deutschland einzigartige und ungewöhnliche kreative Etage geschaffen – aus der Not heraus: Das Unternehmen lebt von Ideen, aber seine Forscher sind nicht frei im Kopf. Hilft das kreative Chaos?
Der Blick aus dem 12. Stock ins Grüne sieht nicht nach unserer technologischen Zukunft aus. Sanfte grüne Hügel wechseln sich ab mit Besiedlungen, zu den Füßen ein Teich, Bänke und ein Fußballfeld. Aber was ist da im Blickfeld? Schmale blaue Linien lassen manche Konturen verschwimmen. Schrift. Hier haben Leute auf das Glas der Fenster geschrieben. „Wie leben wir 2030?“ steht da. Wer weiter lesen will, hat schnell Birgit Thoben im Nacken. „Das hier sind unsere Ideen, das ist unser geschütztes Refugium. Bitte nicht aufschreiben.“ Thoben ist Innovatiosmanagerin beim Technologiekonzern Bosch, sie verantwortet diese besondere Etage namens „Plattform 12“ am neuen Forschungsstandort in Renningen bei Stuttgart. Wie leben wir in Zukunft? Ob an jenen Fensterscheiben die Antwort steht, darf hier leider nicht verraten werden. Die Plattform 12 ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Diese Recherche ist eine Ausnahme – und sie konnte nur stattfinden gegen das hoch und heilige Versprechen, hier keine Geheimnisse und keine konkreten Ideen zu verraten.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Welt am Sonntag, 19. Februar 2017
Ein weltweites Quanteninternet könnte die digitale Kommunikation in Zukunft sicher und unangreifbar machen. Im Zentrum der Forschungen stehen österreichische Wissenschaftler und Quanteneffekte, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen
Es knallten keine Sektkorken, eine Party gab es auch nicht, als Physiker im Jahr 1975 eine Entdeckung machten, die später eine Grundlage der Quantenkommunikation wurde. Ein damals noch unbekannter wissenschaftlicher Mitarbeiter des Physikers Helmut Rauch weist zusammen diesem und Kollegen nach, dass sich Neutronen, weil sie Eigenschaften von Wellen und nicht nur jene von Teilchen haben, ganz seltsam verhalten, wenn sie um ihre Achse gedreht werden: sie verändern ihren Zustand. „Das hatten wir nicht erwartet, dass die Welt nicht die gleiche ist, wenn man sie um 360 Grad dreht“, sagt Anton Zeilinger heute. Die Physiker konnten damals nicht wissen, dass diese Entdeckung jemals eine praktische Relevanz haben würde. „Wenn wir damals gefragt wurden, wozu das alles gut ist, haben wir gesagt: für nichts, das ist für nichts gut, wir machen das nur aus Interesse an der Sache“, sagt Zeilinger, der heute Professor an der Uni Wien ist.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Spektrum.de/Spektrum der Wissenschaft, 17. Januar 2017 - Link
Aktuelle Aktivitäten gegen Fakenews konzentrieren sich vorallem darauf, unseriöse Quellen automatisch zu erkennen. Aber können Algorithmen Falschmeldungen an sich identifizieren? Es schien zeitweise so, als habe die Wissenschaft das schon zu den Akten gelegt. Aber eine Wette und ein Streit unter Forschern gibt neue Hoffnung.
Ende 2016 ächzte die Welt unter dem Problem der Fakenews – und 2017 wird das Problem aller Voraussicht nach nicht kleiner. Angesichts des anstehenden Bundestagswahlkampfs könnte es in Deutschland gar eine größere Dimension bekommen. Da ist eine Hoffnung nicht unberechtigt: Wie schön wäre es, wenn Computer die Welt von Falschmeldungen befreien könnten! Schließlich haben die Algorithmen unter anderem von Facebook Fakenews erst groß werden lassen. Doch während manche daran arbeiten, seriöse Quellen von unseriösen maschinell zu unterscheiden, warnen andere: das ist zu spät, so werden wir dem Phänomen nicht Herr. „Das Problem an seiner Quelle zu fassen ist in diesem Fall nicht die beste Strategie“, sagt Victoria Rubin, Associate Professor an der University of Western Ontario: dafür verbreiten sich Fakenews zu schnell. Zudem gibt es ständig neue Quellen und neue Webseiten, die Falschmeldungen produzieren – hat man eine identifiziert, gitb es bereits zehn neue.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Spektrum.de, 22. Dezember 2016 - Link
Wie sieht unsere Zukunft mit Sexrobotern aus? Wissenschaftler streiten sich über mögliche negative Folgen der Technologie. Während manche gar ein Verbot fordern, setzen andere auf eine wissenschaftliche Durchleuchtung des Themas.
Es ist schon verrückt, was für einen Staub eine Konferenz mit vielleicht 200 Teilnehmern aufwirbeln kann. In London haben sich am 19. und 20. Dezember 2016 Wissenschaftler aus aller Welt getroffen, um sich mit dem Thema "Sex and Love with Robots" zu beschäftigen. Wird es eines Tages Alltag sein, dass Menschen Sex mit Robotern haben? Wird es gesellschaftsfähig sein, einen maschinellen Lebenspartner zu geselligen Events auszuführen? Und wie wird sich das auf unser Zusammenleben auswirken? Die durchaus berechtigten Fragen der Philosophen, Soziologen, Informatiker und Psychologen gingen beinahe unter in der reißerischen Berichterstattung auf der einen Seite und in der Empörung, die das Thema auf der anderen Seite offenbar mit sich bringt.
- Details
- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Spektrum.de, 6. Dezember 2016 - Link
Ein Text über psychologische Profilbildung mittels Facebookdaten schreckt viele auf. Der Text beschreibt aber weder eine neue Technologie, noch ist seine Schlussfolgerung seriös, nach der Trump die Wahl dank Algorithmen gewonnen hat. Dennoch besteht kein Anlass sich zurück zu lehnen, kommentiert Eva Wolfangel.
Ist Bigdata schuld an Trump? Dieses Luder, diese gefährliche Technologie, das sieht ihr ähnlich! Sie bringt Unheil über die Welt – jetzt haben wir den Beweis! So oder ähnlich denken offenbar viele nach der Lektüre des Textes „Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt“. Die vage Hoffnung, dass vielleicht doch nicht Menschen sondern Maschinen schuld sind am Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten, scheint viele zu mobilisieren: der Text dreht derzeit so nachhaltig seine Runden in den sozialen Netzwerken, dass man meinen könnte, er verkünde revolutionäres. Das tut er aber nicht.